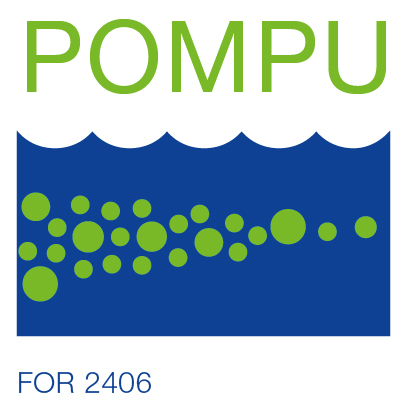Projekte mit Förderung durch die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG)
Concentrate
DFG-Sonderforschungsbereich Transregio 420
Projektsprecher: Prof. Dr. Thomas Schweder und Prof. Dr. Jan-Hendrik Hehemann
Projekthomepage: Link
Laufzeit: 01.10.2025-30.06.2029

Jährlich wandeln Meeresalgen etwa fünfmal so viel Kohlendioxid in Polysaccharide – sogenannte Glykane – um, wie weltweit durch die Verbrennung fossiler Energieträger freigesetzt wird. Diese Glykane bilden eine zentrale Komponente im marinen Kohlenstoffkreislauf. Obwohl marine Bakterien über eine Vielzahl an Enzymen verfügen, die Glykane abbauen und den gebundenen Kohlenstoff wieder freisetzen können, finden sich überraschend große Mengen dieser Zuckerstrukturen in den Weltmeeren. Dies deutet darauf hin, dass bisher unbekannte Faktoren den vollständigen Glykan-Abbau verhindern und somit zur langfristigen Speicherung von Kohlenstoff beitragen.
Hier setzt der TRR 420 an: Ziel des Forschungsprogramms ist es, die molekularen und mikrobiellen Prozesse zu entschlüsseln, die zur Stabilisierung von Glykanen im Ozean führen. In einem interdisziplinären Ansatz kombiniert das Forschungsteam Laborversuche mit Messungen in natürlichen marinen Lebensräumen. Im Fokus stehen dabei die Wechselwirkungen zwischen Algen, Bakterien, Pilzen, deren Glykanen und Proteinen – bis hinunter zur atomaren Auflösung im Ångström-Bereich (also Längenskalen im Bereich von etwa 0,1 bis 1 Nanometer – also 0,1 bis 1 Milliardstel Meter).
WETSCAPES2.0
DFG-Sonderforschungsbereich Transregio 410
Projektsprecher: Prof. Dr. Nicole Wrage-Mönnig und Prof. Dr. Jürgen Kreyling
Projekthomepage:Link
Laufzeit: 01.04.2025-31.12.2028

Dieser SFB wird ein funktionales Verständnis von Feuchtgebiete liefern und die räumlich-zeitlichen Auswirkungen der Wiedervernässung von Mooren auf Landschaftsebene und darüber hinaus untersuchen. Die übergreifenden Forschungsfragen von WETSCAPES2.0 decken kritische Funktionen auf allen räumlichen Skalen von wiedervernässten Feuchtgebieten ab, während die einzelnen Projektbereiche räumliche Skalen darstellen, die für die in WETSCAPES2.0 untersuchten ökologischen Schlüsselprozesse und Ökosystemfunktionen relevant sind. Projektbereich A konzentriert sich auf Akteure und Prozesse auf der operativen Ebene, Projektbereich B befasst sich mit vernetzten Prozessen innerhalb von Mooren und Projektbereich C untersucht die Rolle von Mooren in der Landschaft und darüber hinaus.
Methanogene Archaeen und Methanotrophe sind die wichtigsten Determinanten des potenziellen CH4-Flusses aus Feuchtgebieten in die Atmosphäre. Bislang gibt es keine Zählung der Identität, Häufigkeit und Aktivität von Methanogenen in wiedervernässten Niedermooren sowie ihrer abiotischen und biotischen Einflussfaktoren, obwohl letztere sich vermutlich von denen in natürlichen Feuchtgebieten unterscheiden. Im Rahmen von Projekt A6 wollen wir eine solche Zählung durchführen, indem wir die Häufigkeit und Identität von methanogenen Archaeen in den Screening-Gebieten kartieren. Darüber hinaus wollen wir ihre Rolle für den Treibhausgashaushalt in wiedervernässten Niedermooren bewerten. Wir stellen die Hypothese auf, dass methylotrophe Methanogene für die Methanbilanz von wiedervernässten Niedermooren wichtiger sind als bisher angenommen. Außerdem gehen wir davon aus, dass antagonistische Interaktionen mit schwefelverarbeitenden Bakterien die Häufigkeit und Aktivität von Methanogenen verringern könnten. A6 wird die Methanogene auf allen experimentellen Ebenen von WETSCAPES2.0 untersuchen. Mit Hilfe modernster Proteomik werden wir speziell die Ökophysiologie neuartiger, noch wenig erforschter Methanogene, d.h. der methylotrophen Methanomassiliicoccales, untersuchen.
DiaPieris - Leben in der Warteschleife
Eine proteomische Untersuchung der diapausierenden Pieris napi Puppen
This project is funded by the DFG from 2024 to 2027.

Insekten überstehen raue Umweltbedingungen wie kalte Winter oder anhaltende Nahrungsknappheit oft, indem sie in die Diapause gehen, einen hormonell regulierten Ruhezustand, der die Entwicklung vorübergehend stoppt und die Stoffwechselaktivität reduziert. Unser Projekt, eine Zusammenarbeit zwischen den Abteilungen Mikrobielle Proteomik und Tierphysiologie, untersucht diese natürliche Überlebensstrategie und nutzt fortschrittliche proteomische Ansätze, um die dynamische Regulierung der Diapause beim Grünaderweißling, Pieris napi, zu entschlüsseln. Durch Analysen der globalen Proteinexpression und wichtiger posttranslationaler Modifikationen wie Phosphorylierung und Acetylierung schließt unsere Forschung die Lücke zwischen bereits verfügbaren transkriptomischen Erkenntnissen und den tatsächlichen physiologischen Anpassungen. Final kann so ein umfassendes molekulares Modell der Diapause erstellt werden, das neue Einblicke in die Regulierung des Stoffwechsels, die Widerstandsfähigkeit gegen Stress und die Entwicklungsplastizität bietet.
DIP Projekt MA 1426/23-1 MI 2476/2-1
Evolutionäre, ökologische und strukturelle Grundlagen des mikrobiellen Faserabbaus
Dieses Projekt wird als Teil der Deutsch-Israelische Projektkooperation (DIP) von Januar 2020 bis Dezember 2024 von der DFG gefördert. Unsere Gruppe arbeitet dabei eng im Forschungsverbund zusammen mit Prof. Itzik Mizrahi der Ben-Gurion-Universität des Negev in Israel.
Obwohl der Abbau von pflanzlichen Faserbestandteilen (wie Cellulose und Hemicellulose) ein wesentliches Element des globalen Kohlenstoffzyklus und der terrestrischen Nahrungsketten ist, sind seine Grundprinzipien bisher nicht im Detail untersucht. Eine vielversprechende Methode zur Untersuchung potenter faserabbauenden Mikroorganismen in ihren natürlichen Habitaten ist ein kombinierter Metaproteomics-Metagenomics Ansatz. Der Schwerpunkt unserer Gruppe liegt hierbei auf der Etablierung, Optimierung und Anwendung der MS-basierter Metaproteomanalyse.
Ehemalige Projekte
POMPU FOR 2406
Proteogenomik der marinen Polysaccharidverwertung
Dieses Projekt wurde von 2020 bis 2024 durch die DFG gefördert.
- Projekt B2 „In situ Mechanismen des Polysaccharidabbaus während der Frühjahrsalgenblüte durch zentrale Bakteriengattungen“ zusammen mit Dr. Bernhard Fuchs (MPI Marine Mikrobiologie, Bremen).
Weitere Informationen zum Projekt finden Sie hier.
Bitte beachten Sie: Sobald Sie sich das Video ansehen, werden Informationen darüber an Youtube/Google übermittelt. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Google Privacy.
DFG Schwerpunktprogramm 2002
Kleine Proteine in Prokaryoten, eine unbekannte Welt
Dieses Projekt wurde von 2017 bis 2023 durch die DFG gefördert.
Unsere Gruppe arbeitete im Projekt Z „Proteomics und Peptidomics zur Identifizierung und funktionellen Charakterisierung von sORF kodierten Proteinen“ zusammen mit Prof. Dr. Andreas Tholey (Christian-Albrechts-Universität zu Kiel).
Weitere Informationen zum Projekt finden Sie hier.

Graduiertenkolleg 1870
Bakterielle Atemwegsinfektionen – allgemeine und spezifische Mechanismen der Pathogenadaptation und Immunabwehr
Dieses Projekt wurde von 2014 bis 2018 durch die DFG gefördert.
Weitere Informationen zum Projekt finden Sie hier.
DFG CRC-TRR34
Pathophysiologie von Staphylococci in der Post-Genom Ära
Dieses Projekt wurde von 2014 bis 2018 durch die DFG gefördert.
Weitere Informationen zum Projekt finden Sie hier.